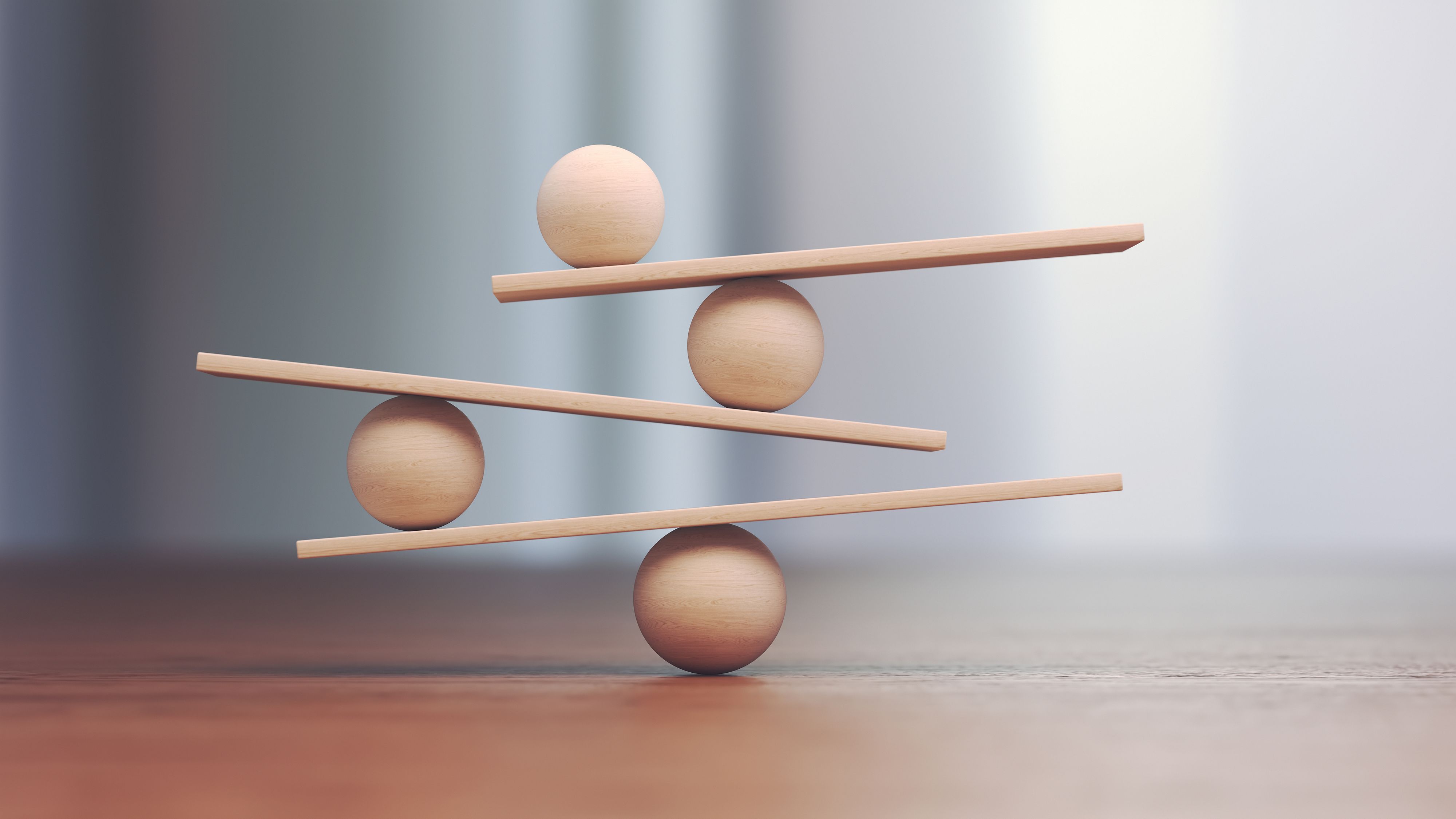Brennpunkt – Keine Absicherung auf Reserve: Wann springt der Staat ein?
Ein neues Working Working Paper der EFV mit dem Titel «Systemrelevante Unternehmen: Eine finanzpolitische Einordnung» zeigt auf, wie Systemrelevanz kriterienbasiert und bereichübergreifend analysiert werden kann und ordnet das staatliche Massnahmensprektrum konzeptionell aus einer wirtschaftspolitischen Perspektive ein.
Wann braucht ein Unternehmen staatliche Nothilfe? Die Krisen der vergangenen 20 Jahren haben den Staat zunehmend in die Rolle des Letzthaftenden gezwungen – ob auf den Finanzmärkten, in der Luftfahrt, bei der Energieversorgung, im Gesundheitssystem oder auch bei der Schadensbewältigung extremer Naturerreignisse.
Staatsinterventionen zur Stützung einzelner grosser Unternehmen, Infrastrukturen
oder Wirtschaftssektoren im Krisenfall beruhen grundsätzlich auf dem Verständnis, dass eine Abfederung durch private Kräfte nicht möglich ist und die Dynamik eines Leistungsausfalls die Stabilität der Volkswirtschaft insgesamt gefährdet, was zu untragbaren Kosten führen kann.
Doch wann ist eine Branche systemkritisch oder ein Unternehmen «too big to fail», «systemrelevant»? Und wie kann verhindert werden, dass der Staat mit seinen Absicherungsinstrumenten gleichzeitig Anreize schafft, die übermässig risikoreiche Unternehmensentscheide provozieren?
Das neue Working Paper der EFV mit dem Titel «Systemrelevante Unternehmen: Eine finanzpolitische Einordnung» geht diesen Fragen nach. Der Beitrag untersucht in einer branchenübergreifenden Betrachtung, wann staatliche Nothilfe für systemrelevante Unternehmen angezeigt ist, und will damit wirtschaftspolitischen Entscheiden eine kriterienbasierte Grundlage bieten.
Systemrelevant sind Unternehmen nur in seltenen Fällen
Die Autoren grenzen dafür die teils unscharfen Begriffe «Systemkritikalität» und «Systemrelevanz» ein. Es zeigt sich, dass die Kritikalität von Infrastrukturen und die Systemrelevanz von Unternehmen mit validen Kriterien erfassbar sind, die wirtschaftspolitischen Entscheiden den Weg weisen können. Als systemrelevant gilt ein Unternehmen, wenn drei Kriterien erfüllt sind:
- Grösse und Marktkonzentration,
- Vernetzung und
- mangelnde Substituierbarkeit.
Die exemplarische Anwendung dieser Kriterien auf die grossen Unternehmen in den hochkritischen Teilsektoren legt nahe, dass die ersten beiden Kriterien oft erfüllt sind, während dies für das Kriterium der mangelnden Substituierbarkeit nur selten gilt. Nur wenige grosse Unternehmen können daher als systemrelevant eingestuft werden – typischerweise aus dem Finanzsektor. Dies schliesst ein, dass Fluggesellschaften oder grosse Stromunternehmen die Kriterien zur Systemrelevanz prinzipiell nicht erfüllen, da Übernahmen in nützlicher Frist möglich wären. Trotzdem ist je nach Krisenursache staatliche Hilfe im Einzelfall beurteilen.
Darauf aufbauend werden konzeptionelle Überlegungen zu staatlichen Massnahmen im Kontext von Systemkritikalität und Systemrelevanz angestellt. Bereits heute verfügt der Staat über ein breites Massnahmenspektrum, das entlang Eingriffstiefe, Interventionszeitpunkt und Design verläuft. Allerdings, so das Papier, sind besonders weitreichende Absicherungsinstrumente wie z.B. Public Liquidity Backstopps und Rettungsschirme mit umfassenden Auflagen zu flankieren, die strenge Konditionalitäten, Gebühren und hohen Transparenzanforderungen vorsehen. Dabei geht es darum, «moral hazard»-Anreize zu vermindern und die Steuerzahlenden vor der Übernahme übermässiger Letzthaftungs-Risiken zu schützen.